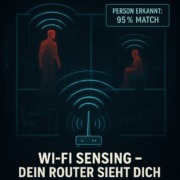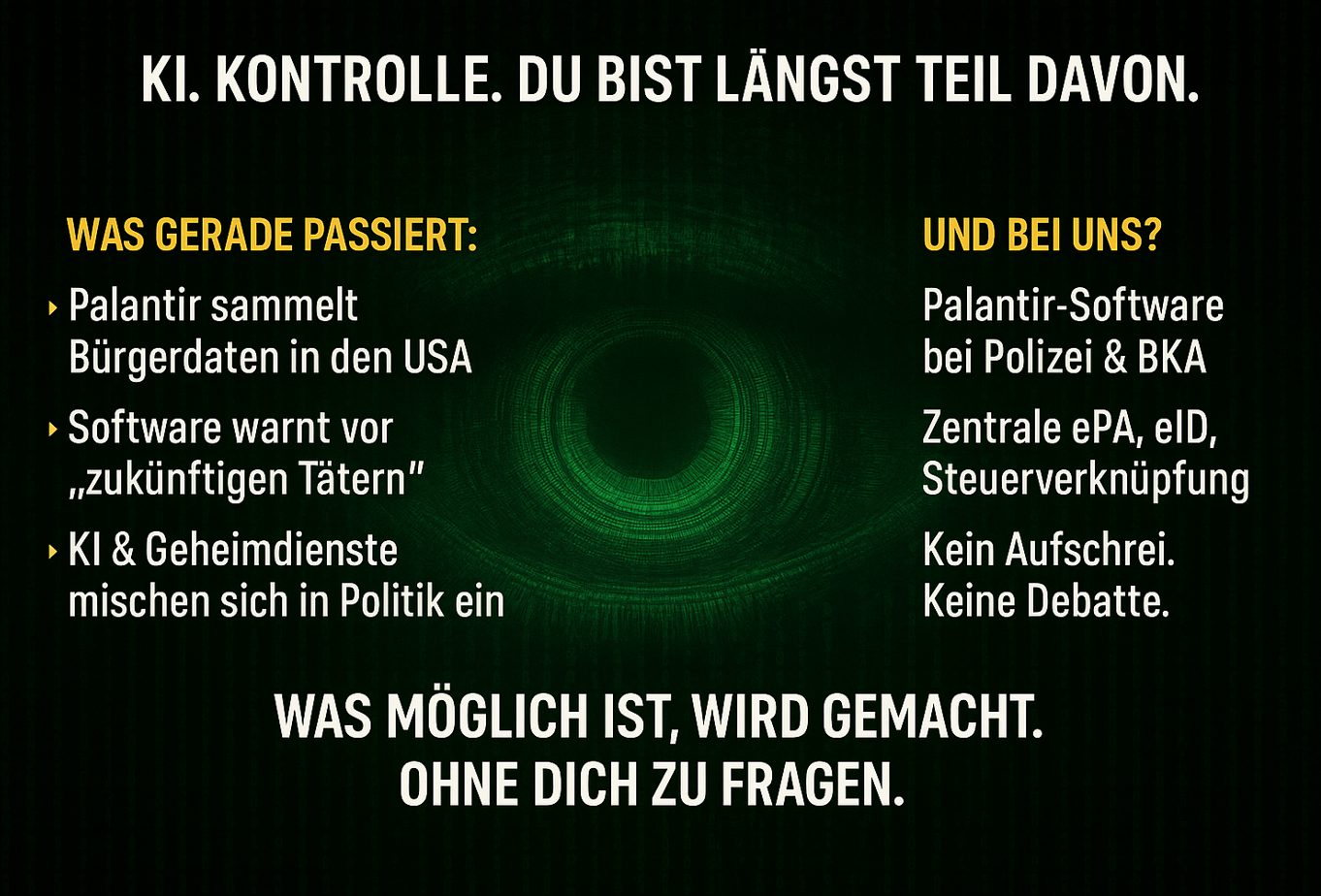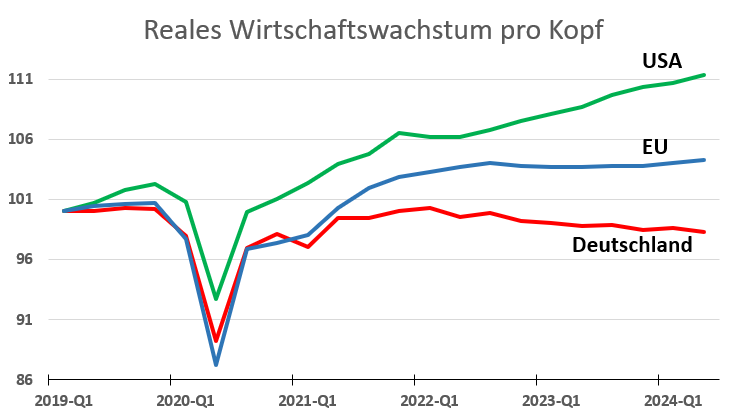In diesem Beitrag geht es darum die „Presse“ zu beleuchten. Nicht erst seit der Corona-Pandemie und der Pegida Bewegung gibt es diesen Begriff „Lügenpresse“. In diesem Beitrag möchte ich verschiedene Belege diskutieren, die einem zu der Annahme bringen, dass die „Medien“ lügen könnten.
Die Pediga-Bewegung und die Lügenpresse
Erinnern Sie sich noch an die Pegida-Bewegung, die 2015 allenthalben das Lied von der Lügenpresse gesungen hatte?
Forsa-Umfragen ergaben damals, dass in etwa 44 Prozent der dazu befragten Personen sehr wohl von der Existenz einer solchen Lügenpresse ausgingen in dem Sinne, dass die Medien „von ganz oben gesteuert“ werden.
Stein des Anstoßes war gewiss die Art und Weise, wie die Flüchtlingsströme in der Medienberichterstattung behandelt wurden, wobei viele Bürger die Situation live in ihrem Wohnbezirk erlebten. Zwischen ihrer realen Wahrnehmung und der geschönten Darstellung durch Journalisten klaffte eine zynische Schere immer weiter auseinander.
Der frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) hat die Integration der Zuwanderer als gescheitert erklärt und erntete für seine Meinungsäußerung, wie so viele andere Menschen auch, einen medialen Shitstorm. Dies veranlasste den Kommunikationsforscher (TU Berlin) Norbert Bolz zu der Klarstellung, dass wir uns alle zurzeit weit entfernt von der Meinungsfreiheit befinden. Die Presse habe es sich angewöhnt, ausschließlich Vorzeigebeispiele sehr gut integrierter Migranten zu präsentieren. Doch zur Wahrheit gehört mehr als das.
Insofern sei der Verdacht, dass hier Manipulationen eine Rolle spielen, nicht von der Hand zu weisen. Viele Medien seien von einem linksintellektuellen, tabuisierten Diskurs durchsetzt.
Der Publizist Roland Tichy veröffentlichte in seinem Internet-Blog kritische Bemerkungen über den russischen Präsidenten Putin. Postwendend überrollte ihn eine erdrückende Protestwelle. Er faste die Situation ganz treffend so zusammen: „Die Grenzen zwischen Lügen, Verschweigen und Selbstzensur sind fließend.“
In dem kleinen sächsischen Ort Sebnitz, der circa 8.000 Einwohner zählt, war der Sohn eines deutsch-irakischen Apotheker-Ehepaares tödlich verunglückt. „Neonazis ertränken Kind“, hieß die unmittelbar prangende Schlagzeile, dabei hatte der Junge ein Herzleiden, das schließlich in einen Badeunfall mündete. Jene Zeitung, die eigentlich darum bemüht war, die Vorgänge richtigzustellen, konnte sich am Ende die Bemerkung nicht verkneifen, dass Neonazis sehr wohl die Täter hätten sein können, bedenkt man, welche Stimmung in Sebnitz tatsächlich vorherrschte. Tichy sieht gerade die deutschen Journalisten in der selbst gewählten Rolle eines Propheten, der mit Worten und Bildern für etwas kämpft, anstatt neutral und unvoreingenommen darüber zu berichten, was seine Aufgabe ist.
Per Gerichtsbeschluss wurde es Tichy verboten, den Namen eines Wirtschaftsbetrügers preiszugeben, der Anleger erneut dubiose Ölaktien aufschwatzen wollte, nachdem er in dieser Angelegenheit bereits eine Haftstrafe verbüßt hatte. Nein, Journalisten dürfen in Deutschland die Wahrheit gar nicht sagen. Der Kodex des Presserats verlangt ganz allgemein, dass über die religiöse oder ethnische Zugehörigkeit überführter und verurteilter Straftäter überhaupt nur in Ausnahmefällen berichtet werden darf. Ist dies Schutz oder Zensur?
Lutz Hachmeister ist ebenfalls Kommunikationswissenschaftler und zugleich Leiter des Adolf-Grimme-Instituts. Er weist darauf hin, dass es intensive Eliteverflechtungen zwischen Politik, Industrie und Journalismus gibt. Und auch die öffentlich-rechtlichen Sendersysteme stecken da angeblich mitten drin. Wir erinnern uns: 2014 erklärte kein Geringerer als das Bundesverfassungsgericht, dass die Strukturen der Aufsichtsgremien des ZDF gesetzeswidrig seien. Dass die Eliten die deutsche Presse von oben steuern würden, wäre ja geradezu eine Verschwörungstheorie, so weit will Hachmeister nicht gehen. Sehr wohl bemerkt das Publikum, dass die Presse deutlich abhängiger hantiert, als sie zugeben würde.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Die Lügenpresse – eine Reportage des Panorama (NDR)
Wenn wir weiter in der Zeit zurückgehen, finden wir weitere Belege. Es gab sogar einmal eine Reportage des NDR zu genau diesem Thema.
Die Reporterin Anja Reschke wollte wissen, was man dem Fernsehen noch glauben könne, und machte sich im Sommer 2011 auf den Weg durch unsere Republik, um dieser Frage nachzugehen. Schon damals war ihre Bilanz ernüchternd, heute wären ihre Ergebnisse geradezu erschreckend, denn von der Wahrheit haben sich die Medien bewusst immer weiter entfernt. Blicken wir also noch einmal zurück.
RTL und der Fall Fischbach – eine Versteigerung als Lüge
St. Goarshausen im Rheintal liegt idyllisch unweit der Loreley. In der RTL-Sendung „Unterm Hammer“ wurde das schöne Haus der Familie Fischbach für 235.000 Euro versteigert. Doch hoppla, mehr als ein Jahr danach stand das Haus noch immer zum Verkauf. Wie denn das?
Alles war nur ein Fake, aber im Abspann der „Doku“ hieß es dreist: „Die notarielle Beurkundung wurde nach der Auktion durchgeführt.“ RTL beteuerte, davon nichts gewusst zu haben, verantwortlich sei die externe Produktionsfirma gewesen. Immerhin wurde die Serie danach eingestellt. Wir kommen später noch einmal darauf zurück.
Scripted Reality – Schicksale nach Drehbuch
Es geht bei RTL im Rahmen der „scripted reality“ um menschliche Schicksale und deren Lebensrealitäten. Alles wird den beteiligten „Schauspielern“ Wort für Wort in den Mund gelegt, denn der Zuschauer würde sich zu Tode langweilen, würde man so filmen, wie das Leben wirklich spielt.
Imke Antjen will am Berliner Alexanderplatz „Beute machen“. Die selbstständige Casterin sucht neue Fernsehgesichter, die vielleicht irgendwann für irgendwelche Soaps zu gebrauchen sind. Dicke Frauen, Punks, Kriminelle eignen sich ganz hervorragend, denn Hartz-IV-Doku-Soaps laufen immer gut.
Gefragt sind gutes Aussehen, Alter bis maximal 45, während Alte, Kranke und Behinderte sofort aussortiert werden müssen. Mit Realität hat diese Fernsehwelt jedenfalls nichts zu tun.
Hartz-IV-Familien als TV-Karikaturen
Da war zum Beispiel die Dame mit ihren zwei Töchtern, alle gut rundlich gebaut und Arbeit suchend. Ramona ist 49 Jahre alt, bringt 105 kg auf die Waage, ist ungepflegt, findet sich selbst aber super, ist also eine sensationelle Type, genau das, was RTL haben will.
Tatsächlich wohnt diese Familie ganz authentisch im Plattenbau in Berlin-Lichtenberg. Mitgespielt haben sie bei der RTL-Reality-Doku „Mitten im Leben“, ihre Rolle heißt: „Hartz-IV-Mutter entlädt ihren Frust an der Tochter.“ Fürs Fernsehen muss ihr Zusammenleben natürlich etwas „krawalliger“ aufbereitet werden.
Verstärkte Klischees – Studien zu den Effekten
Das Marktforschungsinstitut Ipsos ist genau dieser Frage nachgegangen, indem die Wirkung der „Ramona-Doku“ auf Zuschauer untersucht wurde. Und tatsächlich bestätigen die Teilnehmer, dass die gezeigten Klischees das bereits vorhandene „Schubladendenken“ deutlich verstärken. Die Tochter Katrin wurde jedenfalls nach der Austragung der Sendung in der Schule gemobbt.
Als das Kabelnetz für das Privatfernsehen in den 1980er-Jahren verlegt wurde, lag viel Hoffnung darauf, dass mehr Sender zu mehr Standpunkten und damit zu mehr Ausgewogenheit führen würden. Christian Schwarz-Schilling, damals Minister für Post und Fernmeldewesen, wurde nachdenklich, als er die Ausschnitte sah: Der Zuschauer müsse immer wissen, ob er ein „Kunstwerk“ oder einen Bericht über die Wahrheit sieht.
Weitere Beispiele: Pro7, VOX und Fake-Nachrichten
Ein anderes Beispiel ist die Sendung „Entscheidung am Nachmittag“ auf Pro7 mit dem Titel „Meine arbeitslose Mutter treibt mich in den Wahnsinn“. Dass sämtliche Szenen nur nach Drehbuch abgedreht wurden, bestreitet RTL.
„Auf und davon“ auf VOX gibt Daniela Katzenberger als enge Freundin einer Protagonistin aus, die aber erklärte, dass es diese Freundschaft nie gegeben hat.
Und Pro7 NEWS TIME präsentierte eine täuschend echte Nachrichtensendung über eine Geburt in New York – die sich als Werbung für die Serie „Fringe“ entpuppte.
Medienaufsicht und Rundfunkstaatsvertrag
Die Landesmedienanstalten haben die Aufgabe, die Privatsender zu kontrollieren. Prof. Weiß wertet entsprechende Zahlen aus: RTL weist nur noch einen Sachinformationsanteil von acht Prozent auf. Dabei schreibt der Rundfunkstaatsvertrag klar vor, dass auch Privatsender Verantwortung für neutrale Information tragen.
Die Schulermittler – Scheinwelten als Unterhaltung
„Die Schulermittler“ sind ein gutes Beispiel. Alles wirkt wie echt, ist aber inszeniert. Ipsos ließ Probanden die Sendung ohne Abspann sehen. Viele hielten die Geschichten für real und glaubten, Sozialarbeiter seien tatsächlich sofort an jeder Schule verfügbar.
Fazit: Vertrauensbruch mit System
Kommen wir abschließend noch einmal auf die Familie Fischbach zurück. Sie befanden sich tatsächlich in einer finanziellen Notlage und mussten ihr Haus verkaufen, vertrauten dabei auf RTL. Doch die Bieter waren Schauspieler, ein echter Verkauf nie geplant.
Wolfgang Börnsen, medienpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, nannte diese Form der „gespielten Dokumentationen“ nicht vertretbar: Demokratie brauche glaubwürdige Medien. Doch Einfluss auf die Privatsender hat die Politik bis heute kaum.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Der Fall Claas Relotius
Es muss wohl an seinem beachtlichen Charisma gelegen haben, dass es dem Journalisten Claas Relotius immer wieder gelang, Berufskollegen mit erfundenen Geschichten zu blenden. Sogar der Prüfung durch die Dokumentationsabteilung des Nachrichtenmagazins Spiegel hielten seine Darstellungen stand. Dies ging so weit, dass er für seine packenden Reportagen mehrere Journalistenpreise einheimste.
Inzwischen wurde klar, dass Relotius bei mehr als 30 Prozent seiner Artikel überdramatisierte, Teile erfunden oder einfach von anderen Medien kopiert hatte. Es war der Spiegel selbst, der die Affäre kurz vor Weihnachten 2018 an die Öffentlichkeit brachte. Zu dieser Zeit hatte Relotius in Deutschland schon geschrieben für:
- dpa (Deutsche Presse Agentur)
- Cicero
- Frankfurter Allgemeine
- Financial Times Deutschland
- Magazin der Süddeutschen Zeitung
- Tagesspiegel
- Welt
- Zeit
- Spiegel und Spiegel Online
Ende 2018 hat Relotius ein paar seiner Manipulationen unumwunden zugegeben, aber über Details lässt er sich nicht weiter aus.
Eine Fotografin zum Beispiel, die in Moskau Kindergärten für Reiche porträtierte, konnte tatsächlich telefonisch erreicht werden, aber sie beteuerte, Claas Relotius nie persönlich getroffen zu haben. Das bedeutet, dass er ihre Zitate, die sie so tatsächlich mal anderen Journalisten gegenüber geäußert hatte, irgendwo abgeschrieben haben muss.
Die Darstellung, dass sich Relotius erst zum Fälscher entwickelt habe, als er seine Journalistenpreise bereits erhalten hat und der Spiegel daher besonders hohe Anforderungen an ihn stellte, kann so nicht gehalten werden. Erkennbar wurde immerhin ein eher systemisches Problem: Mehr als 50 Faktenchecker prüfen beim Spiegel Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt, doch ob sich der Reporter tatsächlich am Ort des Geschehens aufgehalten hat, wird nicht in die kritische Betrachtung einbezogen.
In der Konsequenz plante der Spiegel die Einrichtung einer Ombudsstelle für interne Whistleblower und forderte seine Reporter unter anderem dazu auf, Tonaufnahmen und Selfies mit ihren Protagonisten zu machen.
Darüber hinaus werden im modernen Journalismus nun sogenannte Dok-Fassungen zunehmend zur Verpflichtung. Dabei geht es um die Dokumentation des Ablaufs der Recherchen einschließlich Quellen-Hinweise, eben wie wissenschaftliche Fußnoten, was nicht immer auf die uneingeschränkte Akzeptanz der neuen Journalisten-Generation stößt, weil es faktisch einen enormen unbezahlten Mehraufwand bedeutet.
Wer nun wissen möchte, was Relotius zu seinen Lügen antrieb, findet vielleicht eine grundsätzliche Antwort im folgenden Beitrag.
Udo Ulfkotte: Gekaufte Journalisten
Aber es geht noch besser. Hierzu muss man sich die Veröffentlichungen des Journalisten Udo Ulfkotte ansehen.
Im folgenden ein Bericht von Ulfkotte aus einer Rede, die er im Bayerischen Wald im Herbst 2015 gehalten hatte:
Zunächst begrüßt Udo Ulfkotte ganz herzlich einen unbekannten, heimlichen Gast im Publikum, der dem Münchener Verfassungsschutz angehören soll, und fordert ihn auf, ganz beherzt alles mitzuschneiden, was hier und heute berichtet wird. Denn sein Thema seien die Medien, die Wahrheit und alles, was damit im Zusammenhang stehe. Immerhin wolle die Mehrheit der Bevölkerung keine Atomwaffen in Deutschland haben und auch Auslandseinsätze deutscher Soldaten würden mehrheitlich abgelehnt, trotzdem sei dies alles Realität. Was die Politiker sagten und täten (was die Medien berichten), was das Volk will, alles divergiere immer weiter auseinander.
So beginnt Udo Ulkotte am Anfang, also zu jener Zeit, als er als frisch gebackener Journalist nach seinem Studium von Jura, Politik und Islamkunde seine ganz persönlichen und zugleich heftigen ersten Erfahrungen mit der Art und Weise der Berichterstattung der Lügenmedien gemacht hat. Von 1986 bis 2003 arbeitete er unter anderem als Kriegsberichterstatter für die FAZ. So wurde er in dieser Eigenschaft in den ersten irakisch-iranischen Krieg entsendet, der von 1980 bis Juli 1986 andauerte.
In Bagdad angekommen wurde er sogleich gemeinsam mit vielen erfahrenen Kriegsberichterstattern aus allen möglichen Ländern in einen Armeebus der Iraker gesteckt, der alle an einen Kriegsschauplatz weit im Osten des Landes an der iranischen Grenze bringen sollte. Zunächst wunderte er sich etwas darüber, dass fast alle einen Benzinkanister mit sich schleppten, aber dann kam ihm der Gedanke, dass das bestimmt eine gute Idee ist, wenn man ins Nirgendwo fährt, wo es keine Tankstelle mehr gibt, dass jeder dem Busfahrer irgendwie aushelfen kann.
Dort angekommen, wo es nichts als Sand und Steine gab, lagen etliche ausgebrannte, zum Teil gepanzerte Fahrzeuge herum, gefühlt seit einer Ewigkeit. Hier stiegen alle aus, um endlich ihre Benzinkanister zum Einsatz zu bringen. Flugs wurde der ganze Schrott dort in Brand gesetzt und die Journalisten posierten aufgeregt vor den Kameras, das Lodern der Flammen im Bildhintergrund. Die mitbeförderten irakischen Schutzsoldaten rannten mit ihren Maschinengewehren wild entschlossen quer durch das Geschehen.
Udo Ulfkotter fragte einen der erfahrenen Journalisten, warum sich alle während ihrer Berichterstattung immerzu so komisch wegducken. Wir spielen anschließend noch das Geknatter von Maschinengewehrsalven auf die Tonspuren. Wenn sich die Berichterstatter dann so ängstlich wegducken, kommt das zu Hause alles ungleich dramatischer rüber, war die Antwort.
Zurück im Al-Rashid-Hotel in Bagdad sollte er nun seinen Auftraggeber erreichen und berichten, aber was konnte oder sollte er eigentlich über seinen merkwürdigen Ausflug in die Wüste berichten? Handys gab es damals noch nicht und die Journalisten hatten es zuweilen schwer, mit den wenigen internationalen Telefonleitungen durchzukommen.
Ulfkotter erreichte aber immerhin seine Mutter, die überglücklich aus allen Wolken fiel, weil ihr Sohn noch lebte. Tatsächlich waren bereits einige der gerade gedrehten Berichte über die „aktuellen blutigen Gefechte an der irakisch-iranischen Front“ bis in die Fernseher des Westens vorgedrungen mit dem Ergebnis, dass die Mütter und Väter der Journalisten sich zu Hause die größten Sorgen um ihre Kinder machten. Dies zeigt, wie überzeugend diese verlogene Form der „scipted reality“ beim Betrachter ankommt.
Dies war also sein erster schockierender Kontakt mit wahrhaftiger Kriegsberichterstattung. Die Alternative, vor der er jetzt stand, war, als unbekanntes Greenhorn zu behaupten, dass das, was die vielen erfahrenen Journalisten berichten, alles gelogen ist, oder einfach erst einmal weiter zu machen, um etwas Geld zu verdienen, was ja für einen jungen Menschen auch wichtig ist. Udo Ulfkotter entschied sich zunächst für die zweite Alternative.
Wer gern wissen möchte, worüber er in seinem Beitrag noch berichtete, sollte sich etwas Zeit nehmen, denn das Video dazu dauert etwas länger als 1,5 Stunden: https://www.youtube.com/watch?v=3ZLgW3hgRBY/
Der Journalist und Autor Udo Ulfkotte verstarb am 13. Januar 2017 nach langer Krankheit, die durch einen Giftgasangriff im Irak ausgelöst worden war, im Alter von nur 56 Jahren an einem Herzinfarkt.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Beitragsbild: 123rf.com adragan8
Dieser Beitrag wurde erstmalig 2022 erstellt und am 25.8.2025 letztmalig überarbeitet.