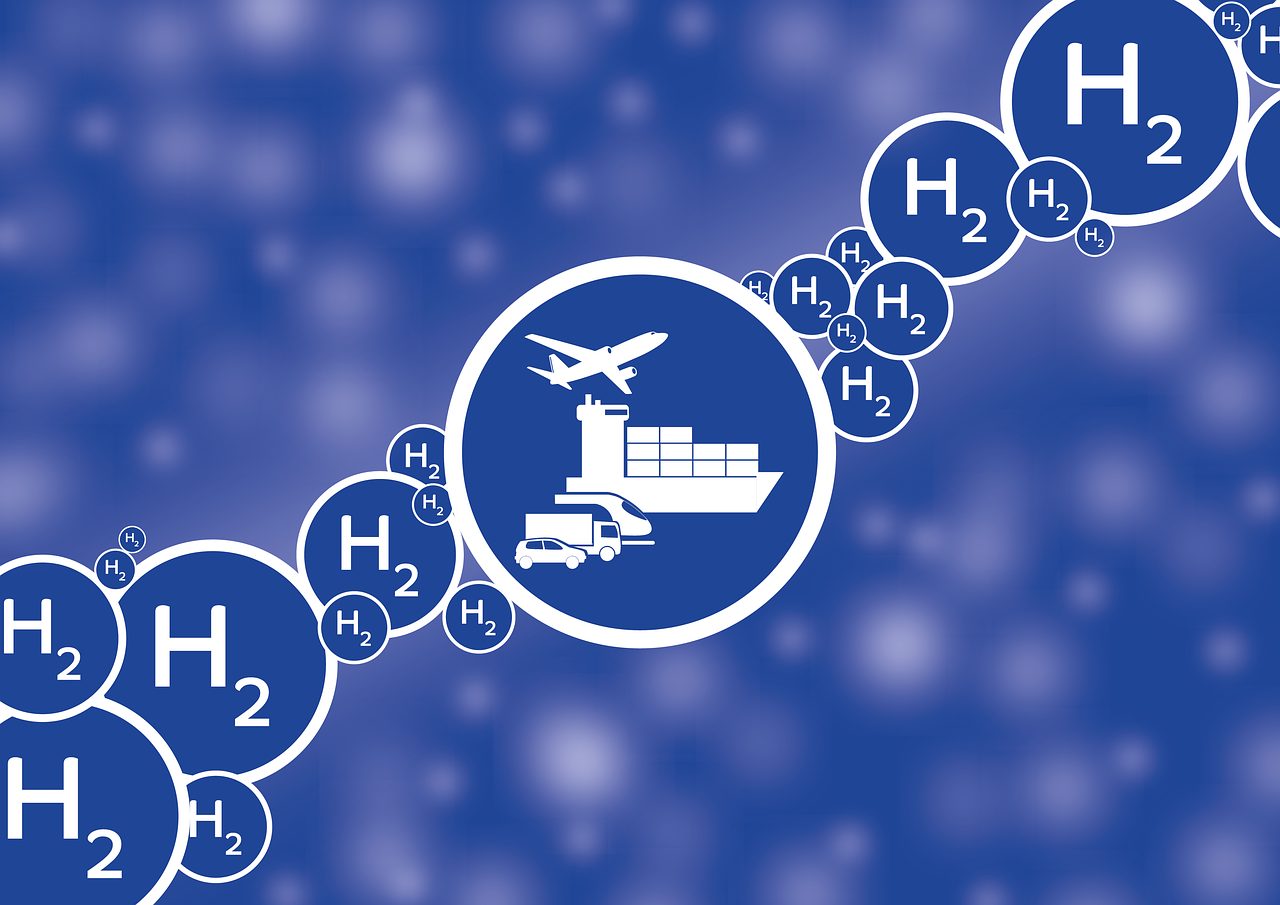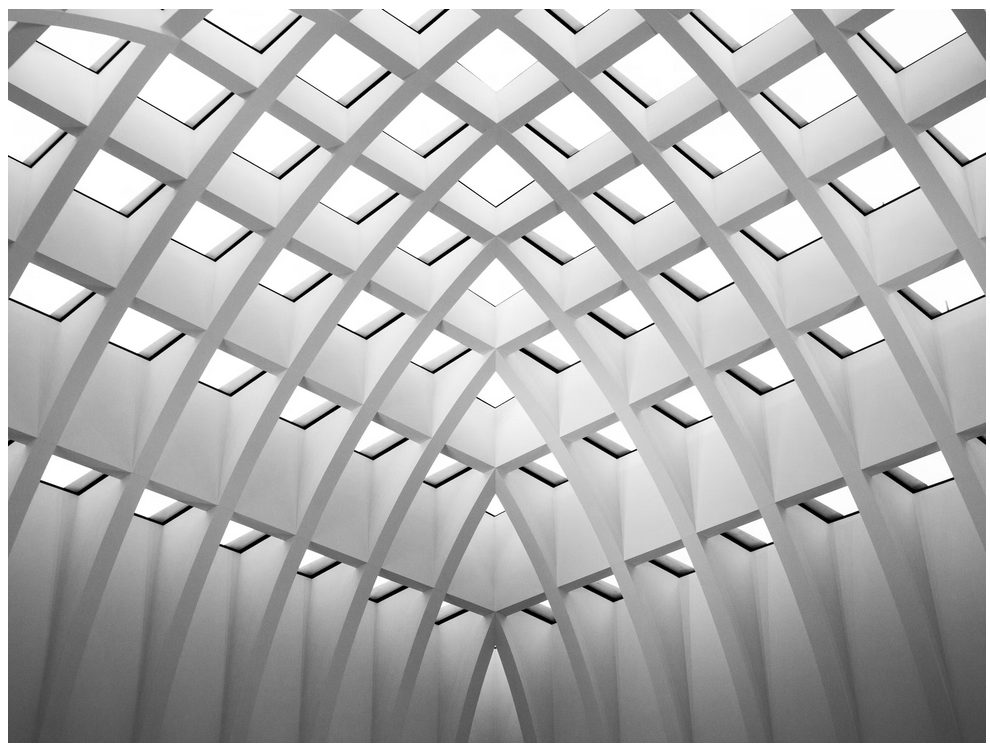Bevor nun die Sache gleich wieder in Vergessenheit gerät: Am 8. September 2023 beschloss der Bundestag die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), das gern kurz als Heizungsgesetz bezeichnet wird.
Zuvor war in dieser Sache die Lobby hochgradig umtriebig. Das zunächst überaus ambitionierte Heizungsgesetz wurde dabei so kastriert, dass der angestrebte schnelle Ausstieg aus dem klimaschädlichen, fossilen Heizen wohl auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird. Immerhin dürfen die Verbraucher nun deutlich länger Gasheizungen einbauen, um ihren fossilen Brennstoff immer teurer einzukaufen.
Aber natürlich gibt es einflussreiche Kräfte, die ein gesteigertes Interesse daran haben, die Wärmewende in deutschen Kellern auszubremsen. Fakt ist, dass bei den offiziellen Lobbytreffen zum Thema Heizungsgesetz die Gas- und Immobilienlobby ganz vorne auf der Matte stand, allen voran der Verband der Kommunalen Unternehmen (VKU).
Schauen wir einmal hin, wer da wen getroffen hat
Zwar werden derartige Informationen in Deutschland nicht veröffentlicht, aber man darf die Bundesregierung dazu befragen. Zum Beispiel macht die Organisation „FragDenStaat“ so etwas regelmäßig. Was gab also die Bundesregierung über die Lobbytreffen zum Heizungsgesetz einschließlich der kommunalen Wärmeplanung seit Anfang 2022 Preis?
Insgesamt kam es zu 53 Treffen zwischen den Spitzen von beteiligten Bundesministerien und verschiedenen Lobbyakteuren. Seitens der Regierung waren beteiligt:
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
- Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)
- Bundeskanzleramt
Die Gesprächspartner waren hier der Kanzler selbst, Minister, Staatssekretäre und Abteilungsleiter. Betrachtet man jeden einzelnen Lobbyakteur etwas genauer, gab es sogar 116 (teilweise mehrfache) Treffen mit den Vertretern der Politik.
Die meisten Treffen erfolgten mit Vertretern kommunaler Spitzenverbände. Dabei trifft man unter anderem auf den Deutschen Städtetag und den Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB), die Interessenvertretung der Stadtwerke oder den Verband der Kommunalen Unternehmen (VKU). Diese insgesamt 33 Treffen nehmen im Vergleich in der Tat eine Spitzenposition ein.
An den Positionen 4, 5 und 6 kommen dann mit insgesamt 14 Treffen der Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer „Haus & Grund“, der Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft „Zentraler Immobilienausschuss“ (ZIA) und der „Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen“ (GdW).
Das Schlusslicht unter diesen illustren Freunden der Kommunikation bilden der „Bundesverband der Erneuerbaren Energien“ und der „Deutsche Naturschutzring“ (DNR). Organisationen wie der „Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie“, der „Zentralverband des deutschen Baugewerbes“ und ein paar Umweltverbände tauchen zwar auf, gebärdeten sich aber zurückhaltender. Wir können also feststellen, dass genau jene Akteure im Bundestag ein und ausgingen, die ein nicht unerhebliches Interesse an einem späten Ende für fossile Heizungen haben.
Der Präsident Kai Warnecke des Eigentümerverbandes Haus & Grund ist zufällig Mitglied des Beirats des Gaslobbyverbands „Zukunft Gas“. Er hat das Gesetz in der Bild-Zeitung scharf kritisiert und dies mit der Forderung verbunden, dass der Einbau von Gasheizungen weiter erlaubt werden müsse.
Mit 13 Lobbytreffen war der VKU ziemlich emsig dabei, wobei es gar nicht hochrangig genug zugehen konnte. Zweimal tauchten Verbandsvertreter im Bundeskanzleramt auf, um mit keinen Geringeren als Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und Staatssekretär Jörg Kukies zu reden. Drei Treffen fanden mit Bundesbauministerin Klara Geywitz statt und drei weitere mit Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Zur Zukunft der deutschen Heizungen hat sich der VKU klar positioniert, indem er mehrfach öffentlich dafür plädierte, dass Gasheizungen noch bis zum 31. Dezember 2044 erlaubt bleiben sollen und die gegenwärtige Wasserstoff-Hysterie ausgebremst werden müsse.
Damit vertritt der VKU die Wünsche vieler Stadtwerke, die um ihre lukrativen Einnahmen aus den Gasverteilnetzen fürchten. Einige Experten haben bereits die Warnung ausgesprochen, dass Wasserstoff zum Heizen zum einen zu teuer und zum anderen zu ineffizient sei. Überhaupt würde er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen.
Inzwischen haben 25 Stadtwerke ihre Mitgliedschaft im Lobbyverband Zukunft Gas gekündigt, weil sie „keinen Glauben mehr an die Zukunft von Erdgas haben“. Sie nehmen nämlich schmerzlich zur Kenntnis, dass es bei Neubauten kaum noch Anfragen zu einem Netzanschluss für Gas gibt.
Kurzer Rückblick
Während der ersten Junihälfte 2023 wurde das Heizungsgesetz im Bundestag unter den Ampel-Fraktionen so verbissen verhandelt, dass keine Einigung in Sicht war. Schließlich haben sich Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Vizekanzler Habeck in die Sache einschaltet, um stolz am 13. Juni 2023 die Einigung zu verkünden, die allerdings eine Verwässerung der bisherigen Entwürfe darstellt, denn das vorgesehene Verbot neuer Gasheizungen ab 2024 war damit erst einmal vom Tisch. Dieses kommt erst 2028 zum Tragen, wenn die kommunale Wärmeplanung fertig ist, wobei danach noch sogenannte „H2-ready-Heizungen“ eingebaut werden dürfen, vorausgesetzt, das zuständige Stadtwerk kann einen Transformationsplan für die Wasserstoffnetze vorlegen.
Die alles entscheidenden Gesprächstermine zum GEG sahen im Einzelnen so aus:
2. Juni 2023: Staatssekretär Jörg Kukies trifft den Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Verbands für das Gas- und Wasserfach (DVGW).
5. Juni 2023: Austausch zwischen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und der Präsidentin und Hauptgeschäftsführerin vom „Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft“ (BDEW)
9. Juni 2023: Der Präsident des VKU Ingbert Liebig hat eine Unterredung mit Staatssekretär Kukies zum Thema Gasverteilnetze und Wasserstoffinfrastruktur.
Mithilfe des sogenannten klimaneutralen Wasserstoffs als „Zukunftstechnologie“ wollen alle drei Verbände erreichen, das gute Geschäft mit fossilem Gas so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Die Lobby-Plattform „H2vorOrt“ wird übrigens gemeinsam von VKU und DVGW betrieben mit dem Ziel, Wasserstoff fest im Heizungsgesetz zu verankern.
Fazit:
Fakt ist, dass das Bundeskanzleramt wenige Tage vor der Einigung über das GEG lediglich mit den genannten drei Organisationen Kontakt hatte. Wissenschaftler oder Mitarbeiter von Umweltorganisationen, die eine eher kritische Meinung über das Heizen mit Wasserstoff vertreten, kamen gar nicht zu Wort. Insofern bekamen Scholz, Habeck und Lindner in der Sache keine ausgewogene Beratung.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Beitragsbild: pixabay.com – akitada31