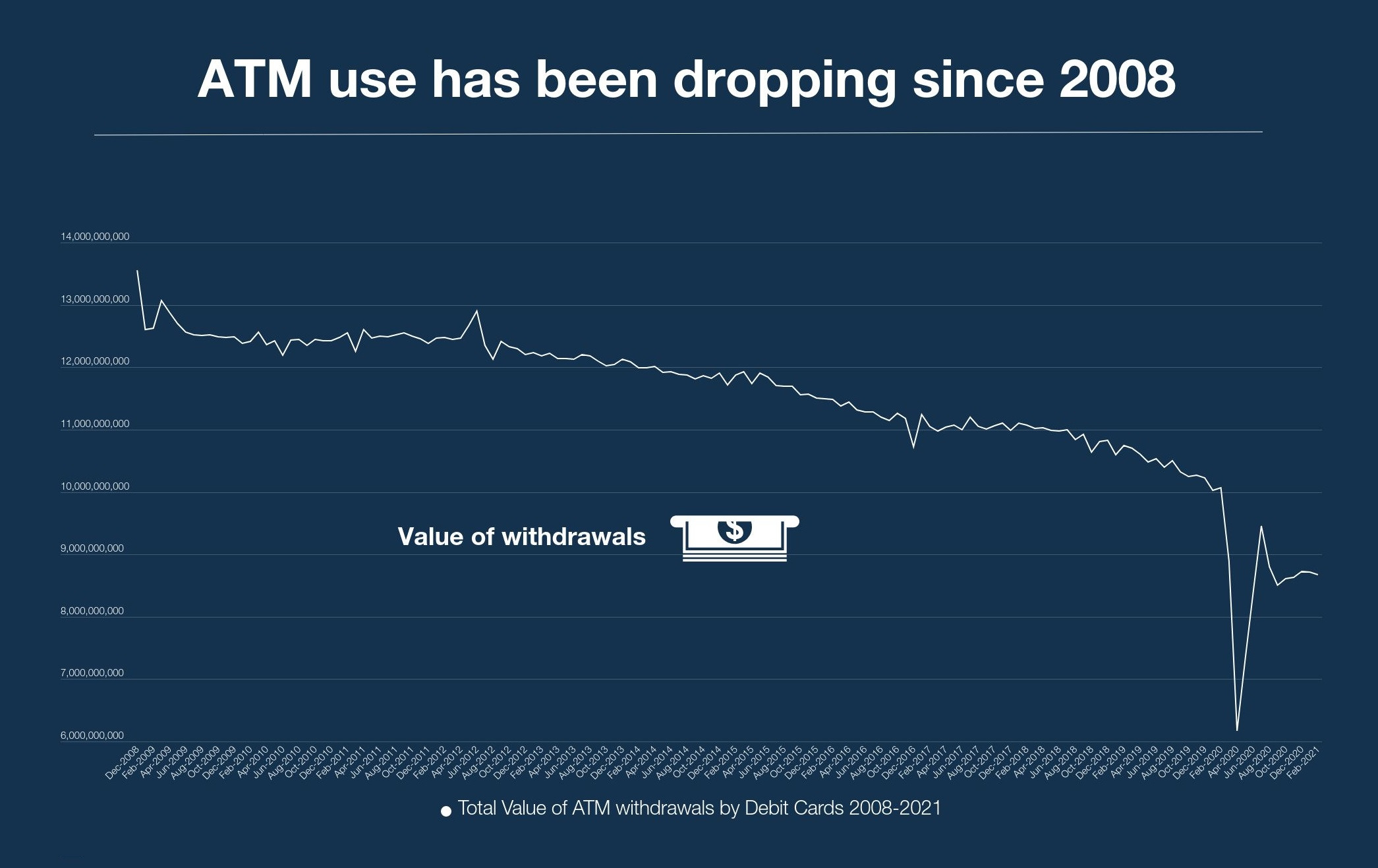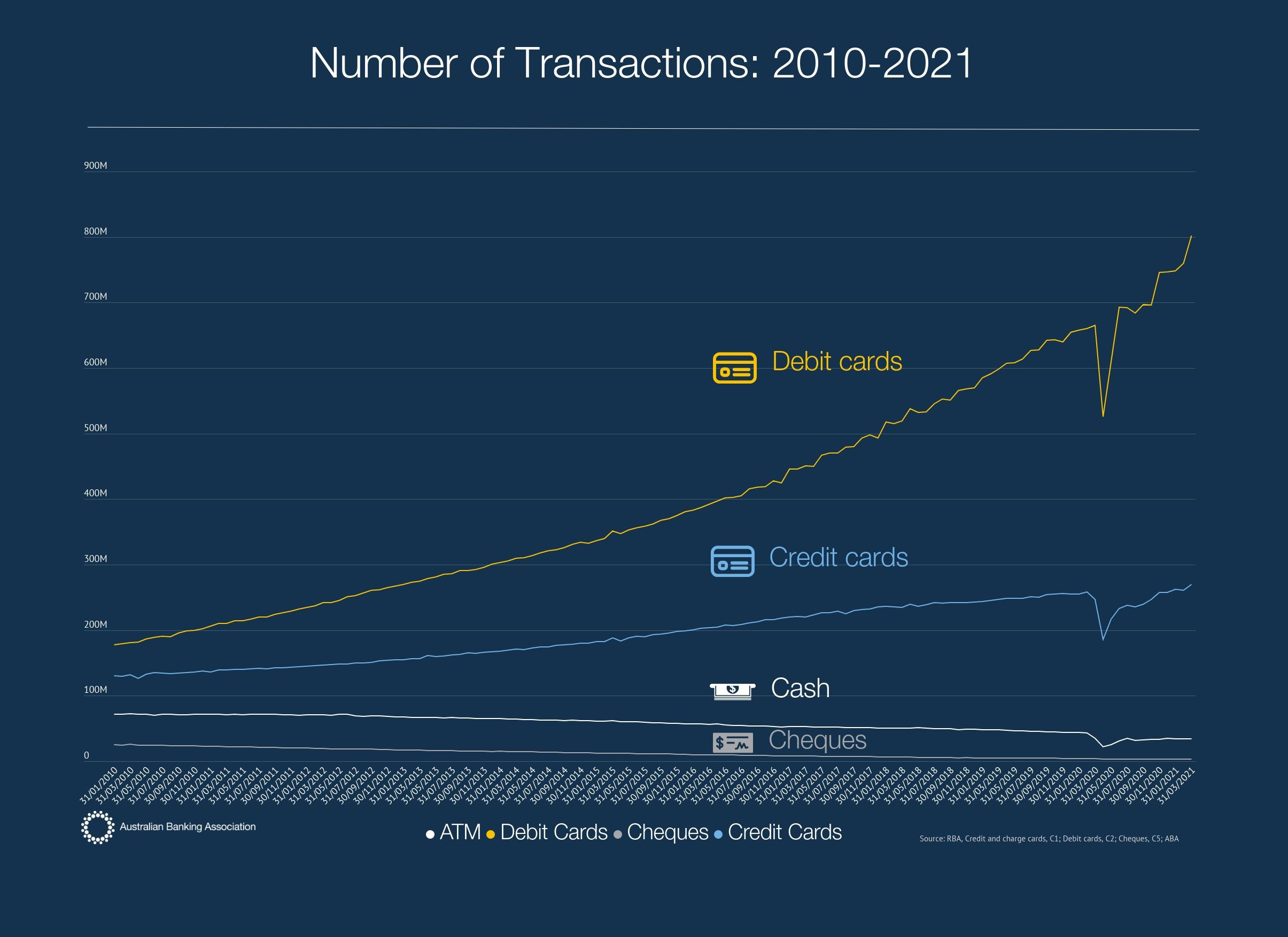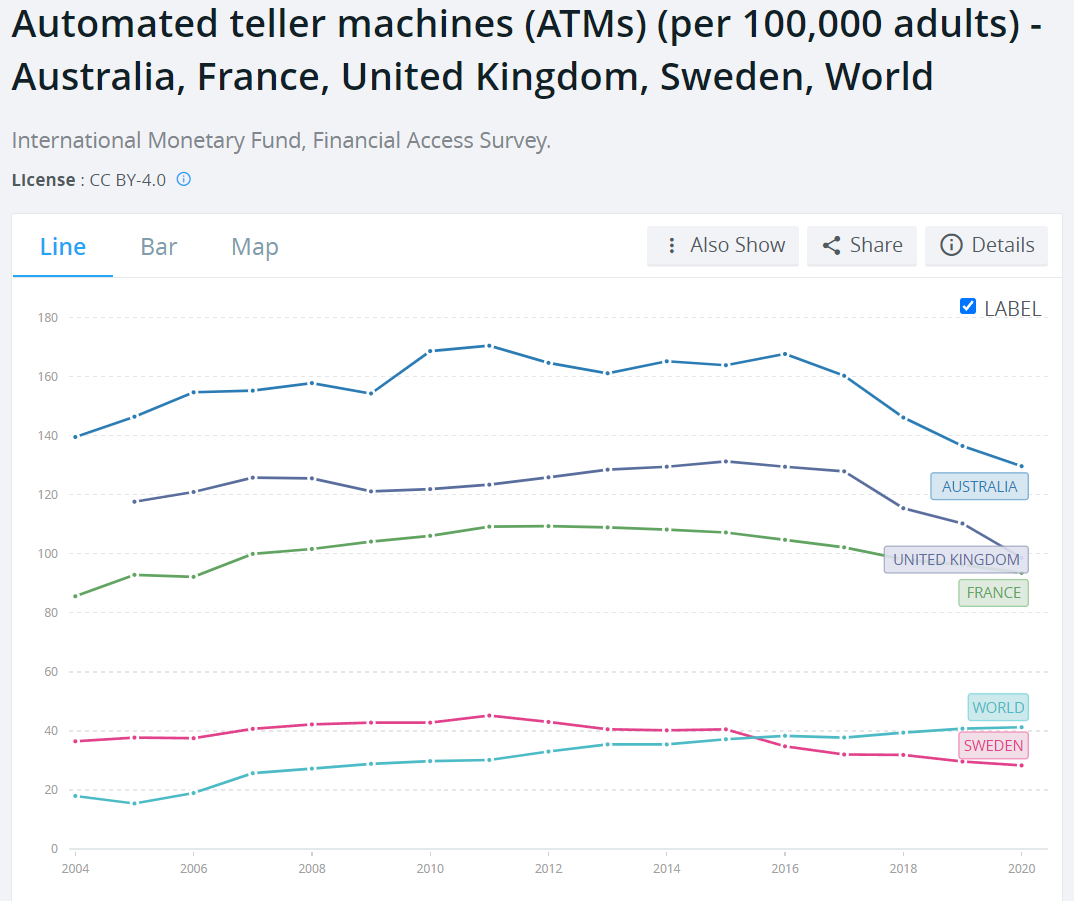Obwohl viele Experten die wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle nicht nur für zu teuer, sondern auch für ineffizient halten, macht das Wirtschaftsministerium massiv Fördergelder für das zukünftige Betanken von Fahrzeugen mit Wasserstoff frei. So etwas funktioniert immer dann, wenn ein gut geschmiertes Lobby- und Freundschaftsnetzwerk im Gange ist.
Es besteht der „dringende Tatverdacht“, dass sich die Adressaten der Fördergelder unmittelbar aus den engen (persönlichen) Kontakten zwischen den Geldgebern und Empfängern aus einem Lobbynetzwerk ergeben haben. Offenbar werden Compliance-Regeln im Verkehrsministerium nicht beachtet oder es gibt dort keine.
Die Ski-Connection
Da gibt es zum Beispiel etliche Damen und Herren, die neben ihren dienstlichen Nahtstellen gern in den gemeinsamen Ski-Urlaub fahren. Zu diesem erlauchten Kreis gehören unter anderem zwei Spitzenfunktionäre des Deutschen Verbandes für Wasserstoff- und Brennstoffzellen (DWV), Oliver Weinmann und Werner Diwald. Letzterer führt dort den Vorstandsvorsitz, während Weinmann als ehrenamtlicher Präsident fungiert.
Der DWV ist jener Lobbyverband, der sich für Unternehmen engagiert, die wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen produzieren. „Der dritte Mann“ mit dem Faible fürs Skifahren heißt Klaus Bonhoff.
Er ist im Verkehrsministerium der Leiter der Abteilung Grundsatzfragen und für die Vergabe von Fördermitteln mitverantwortlich. Wegen seines überaus ausgeprägten Interesses am Thema Brennstoffzelle trägt Bonhoff bereits den Beinamen „Mister Wasserstoff“.
Im Frühjahr 2021 kam es auf einer Veranstaltung zu einem dienstlichen Treffen zwischen Bonhoff und dem skibegeisterten Brennstoffzellen-Lobbyisten Diwald. In ihrem Gespräch ging es darum, ob das Verkehrsministerium möglicherweise an einer Kommunikations- und Vernetzungsplattform „interessiert“ ist, die allerdings beim Brennstoffzellen-Lobbyverband angesiedelt sein würde.
Explizit wurde dabei auf das Förderprogramm des Verkehrsministeriums hingewiesen. Die Plattform HySteel (gleicher Verband) wurde ja bereits im Rahmen dieses Programms gefördert.
Es dauerte dann nur noch paar Tage, da erhielt Bonhoff zu dem geplanten Projekt „erläuternde Unterlagen“, wobei Diwald das Anschreiben recht persönlich mit „Lieber Klaus“ eröffnete. Bonhoffs Begleittext zu dem Vorgang an seinen Referatsleiter enthielt die Direktive: „Wie besprochen, können wir analog zu BMU Vernetzung-Kommunikation fördern“.
Immerhin lag Diwald ja schon eine mündliche Zusage von Bonhoff vor. Es sollte aber noch ein Jahr dauern, bis das neue Projekt „HyMobility“ vom Verkehrsministerium mit 1,4 Millionen Euro ausgestattet wurde. In ganzer Konsequenz hielt Bonhoff, den Staatssekretär vertretend, zum Start des Programms die Eröffnungsrede.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Das Verkehrsministerium durfte nun nicht tatenlos bleiben
Das Verkehrsministerium hat in der Sache tatsächlich eine Untersuchung eingeleitet, Ende August 2023 lag sogar ein erster Zwischenbericht vor. Staatssekretär Stefan Schnorr hatte inzwischen die Existenz eines Freundeskreises, dem sowohl Bonhoff als auch einige Vertreter des Brennstoffzellen-Lobbyverbandes angehören, bestätigt.
Eine Nachfrage der Bundestagsfraktion der Union beantwortete das Verkehrsministerium dahingehend, dass Bonhoff selbst mit dem eigentlichen Bewilligungsverfahren nichts weiter zu tun hatte.
Das Verkehrsministerium argumentierte aber selbst, dass Fördermaßnahmen grundsätzlich stark korruptionsgefährdet sind und deshalb alle Mitarbeiter des Verkehrsministeriums ganz gezielte Schulungen erhalten, um sie dagegen zu sensibilisieren.
Auch und gerade der renommierte Compliance-Experte Professor Manuel Theisen sagt, dass private Verbindungen und die Vergabe öffentlicher Gelder einfach nicht zusammenpassen. Im Übrigen hat das Verkehrsministerium bislang nur die Vorgänge bis August 2019 genauer angeschaut, was so alles danach passierte, ist offenbar uninteressant.
Nach dem oben bereits erwähnten Zwischenbericht gab es tatsächlich noch einen Abschlussbericht, doch beide Varianten sind der Öffentlichkeit (natürlich) nicht zugänglich.
Die von Bonhoff geleitete Abteilung im Verkehrsministerium ist jedenfalls verantwortlich für die Vergabe sehr hoher Fördersummen. In diesem Zusammenhang zu erwähnen ist unbedingt das „Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie“ (NIP). Innerhalb des Zeitraums 2017 bis 2022 wurden im Rahmen dieses Förderprogramms immerhin knapp 1,7 Milliarden Euro für verschiedene Wasserstoff-Projekte bewilligt.
Eingestellt worden war Bonhoff von dem damaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Bereits zu diesem Anfangszeitpunkt konzentrierte sich „Mister Wasserstoff“ konsequent auf die Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und übernahm später den Chefsessel der bundeseigenen NOW GmbH, deren Aufgabe unter anderem die Koordinierung der Fördermittelvergabe in diesem Bereich ist.
Bonhoff ist nun mal ein „Hans in allen Gassen“. Er ist zum Beispiel Mitglied im Beirat des Gaslobbyverbandes „Zukunft Gas“, was ihm enge Kontakte zu den großen Öl- und Gaskonzernen wie VNG und Shell beschert. Der neue Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) übernahm Bonhoff, wenngleich nach einem Regierungswechsel auch Personaländerungen auf Bonhoffs Ebene durchaus üblich sind.
Die NOW GmbH ist ein mächtiger Akteur in Sachen Fördermittelvergabe
Bonhoffs vorheriger Arbeitgeber NOW wurde im Jahre 2008 von der Bundesregierung eingerichtet. Das Unternehmen sollte die Mittel aus dem Wasserstoff-Förderprogramm NIP koordinieren. Eine wichtige Aktivität besteht darin, Vorentscheidungen hinsichtlich der Mittelvergabe gemeinsam mit dem Projektträger Jülich zu treffen.
Dabei arbeiten einige potenzielle Geldempfänger mit der NOW GmbH zusammen. Manche sind zum Beispiel Mitglied in einem beratenden Beirat von Shell, Total oder VNG (Gaskonzern).
Die Fortsetzung der fossilen Geschäftsmodelle gelingt in der Tat über wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen und E-Fuels, zumindest sehr viel besser als mittels der batteriebetriebenen Elektromobilität, wenngleich diese einen besseren Wirkungsgrad aufweisen kann.
Auf jeden Fall kann per Wasserstofftechnologie die bestehende Infrastruktur der Tankstellen und Lieferketten aufrechterhalten bleiben. Um ganz sicherzugehen, wurde Ende 2019 die „Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur“ ebenfalls bei der NOW angesiedelt. Auf diese Weise erstreckt sich ihr Wirkungsbereich nun auch auf den weiteren Ausbau der batteriebetriebenen Elektromobilität.
Bonhoffs Freund und Nachfolger auf dem Posten des NOW-Geschäftsführers ist Kurt-Christoph von Knobelsdorff, ebenfalls ein bekennender Fan der Brennstoffzelle. Außerdem gehört Knobelsdorff dem Beirat der E-Fuels-Alliance an, die im Auftrag von ExxonMobil, Porsche und Siemens Energy die Lobbyarbeit für E-Fuels übernommen hat.
Wir wollen das Ganze noch einmal richtig einordnen: Die Lobby-Organisation „Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband“ (DWV), genauer gesagt deren „Fachkommission HyMobility“ erhält 1,4 Millionen Euro aus dem Wasserstoff-Förderprogramm NIP, welches von der NOW GmbH koordiniert wird. Dieser ominösen Fachkommission HyMobility gehören führende Vertreter dieser Unternehmen an:
- BMW
- Shell Hydrogen
- Uniper Energy
- Siemens Energy
- Fraunhofer-Institut
- H2Mobility (Wasserstoff-Tankstellen-Betreiber)
- NOW GmbH (im Bundeseigentum)
Das Ziel des Projekts HyMobility besteht darin, in einem engen Austausch mit der Politik einen regulatorischen Rahmen zu setzen, der die Förderung der Brennstoffzelle konzeptionell voranbringen soll. Um das Ganze etwas mehr auf den Punkt zu bringen:
HyMobility ist ein Netzwerk von Unternehmen, das sich eine erfolgreiche Brennstoffzellen-Lobbyarbeit vorgenommen hat. Das heißt, der Wirtschaftslobbyverband DWV bekommt faktisch staatliche Zuschüsse für seine angestammten Aufgaben, nämlich die Pflege von Netzwerken und Lobbyarbeit.
Beratungsfirmen zur Akquise öffentlicher Gelder sprießen wie Pilze aus dem Boden
Die Wasserstoff-Lobbyisten Diwald und Weinmann haben inzwischen eigene Firmen gegründet, die bereits Teil des Wasserstoff-Netzwerks sind. Diwald ist, abgesehen von seinem Job beim DWV, der geschäftsführende Gesellschafter bei der Firma PTXsolutions, die als Dienstleistungen die Aquise öffentlicher Gelder und Politikberatung anbietet.
Weinmann gründete 2023 die Firma HyAdvice, deren Dienstleistung ebenfalls in Beratungen zur Fördermittelakquise im Kontext von Wasserstoff-Projekten besteht. Auch er sitzt bei der NOW GmbH exponiert im Beirat. Es ist offenkundig, dass beide Firmen große Vorteile aus dem Insider-Wissen über die Vergabe von Fördergeldern ziehen, über das Diwald und Weinmann durch ihre berufliche und private Nähe zu Bonhoff verfügen.
Was für ein Zufall?
Weinmanns Schwiegersohn Lorenz Jung ist zufällig auch in der Wasserstoffbranche tätig. Seit 2021 mischt er in der Geschäftsführung von H2Mobility mit und ist seit April 2023 sogar Sprecher des Unternehmens. Beteiligt an H2Mobility sind unter anderem Shell, Daimler, BMW und TotalEnergies.
Als wenn es gar nicht anders geht, leitet H2Mobility eine Arbeitsgruppe innerhalb der Fachkommission HyMobility von DWV an. Wie praktisch, weil beide Fördergelder von NOW erhalten, da weiß man doch, wie es geht. Ach ja, das hätten wir fast vergessen: Jungs Ehefrau, Weinmanns Tochter, ist die Teamleiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei der NOW GmbH. Aber gut, so etwas haben Sie sich als Leser bestimmt schon gedacht.
Wie war das doch gleich im Fall Graichen?
Im Frühjahr 2023 stolperte der ehemalige Staatssekretär Patrick Graichen darüber, dass er die Vergabe von Fördermitteln an den BUND / Landesverband Berlin mitunterzeichnet hat, weil dort im Vorstand damals seine Schwester saß.
In diesem Fall wurden im Ministerium schon zuvor Regeln bezüglich des Umgangs mit familiären Bindungen aufgestellt. Da diese nicht eingehalten worden sind und die öffentliche Kritik zu Recht aufschäumte, musste die Entlassung erfolgen. Der Fall Bonhoff zeigt zur Causa Graichen auffällige Parallelen.
Jedenfalls waren dem zuständigen Fachreferat des Verkehrsministeriums nach eigener Aussage „auf Arbeitsebene“ weder die Beratungstätigkeiten von Diwald und Weinmann noch die familiäre Bindung von Lorenz Jung bekannt gewesen.
Unsere Compliance-Regeln bedürfen einer grundlegenden Überprüfung
Dass es sich bei den Wasserstoff-Netzwerkern um eine überschaubare Gemeinschaft handelt, die an Brennstoffzellen arbeitet und forscht und auch Fördergelder dazu vergibt, ist eigentlich schon lange bekannt. Insofern ist wohl kaum jemand über die beruflichen und persönlichen Verflechtungen zwischen der NOW GmbH und dem Abteilungsleiter Klaus Bonhoff sowie den Empfängern der Fördergelder großartig überrascht.
Fakt ist, dass nicht unbeträchtliche Steuergelder einseitig in eine umstrittene Technologie gesteckt wurden, wodurch sehr wahrscheinlich sogar die Transformation des Industriestandorts Deutschland in eine suboptimale Richtung gedrängt wurde.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2024 erstellt.