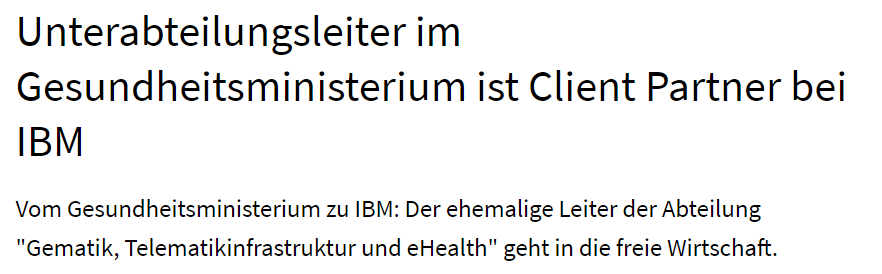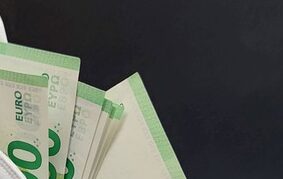Zur Einstimmung einige wenige Zitate von Jens Spahn:
– „Hartz IV bedeutet noch lange keine Armut.“
– „Eine Rentenerhöhung ist in erster Linie ein Wahlgeschenk für Senioren.“
– „Wer fürs Alter vorsorgt, darf nicht der Gekniffene sein.“
Jens Spahn war und ist ehrgeizig. Mit kaum mehr als 20 Jahren saß er bereits im Bundestag. Heute heißt es: Spahn kann Lautsprecher, Kampfkandidatur und gewiss auch Kanzler.
Seit den Berichten über Spahns neue Villa in Berlin sind seine Anwälte gegenüber Medien und Gerichten emsig um gewisse Klarstellungen bemüht.
Zum Beispiel darf der Kaufpreis nicht genannt werden. Der Corona-Sommer 2020 ist ja auch nicht gerade der passendste Zeitpunkt für eine Offenbarung des Reichtums des deutschen Gesundheitsministers.
Spahn scheinen zwei Dinge gut von der Hand zu gehen: das Schmieden seiner politischen Karriere und seine unübersichtlich verflochtene Investment-Strategie. Die Korrelation beider Komponenten war schon beeindruckend. Jeder Karrieresprung war mit großem finanziellem Vorankommen verknüpft und umgekehrt.
Man kann es auch so ausdrücken: Einige seiner Investments konnten überhaupt nur deshalb greifen, weil die politische Karriere stimmte. Um Interessenkonflikte sollen sich andere scheren, aber doch nicht ein Jens Spahn.
Spätestens die Maskenaffäre weckte dummerweise „schlafende Hunde“ in der Öffentlichkeit, die nun laut bellend Transparenz über die Nebentätigkeiten von Abgeordneten und Ministern einfordern. Sogar in der CDU werden jetzt Stimmen hörbar, die es wagen, den Millionen-Minister vorsichtig zu kritisieren.
Das „Projekt Spahn“
Oktober 2002: Nachdem der 22-jährige Jens Spahn seine zweijährige Ausbildung zum Bankkaufmann erfolgreich beendet hat, setzt er sich in einer lokalen Kampfabstimmung in seinem Wahlkreis durch und wird Abgeordneter im Bundestag. Schon damals liebäugelte Spahn selbstsicher mit der Idee, Bundeskanzler zu werden.
Praktisch am gleichen Tag erwarb Spahn von einem Parteifreund jene Immobilie, die er noch heute als seinen Hauptwohnsitz führt. Gleich zwei Kredite musste er dafür aufnehmen, was durch die Wahl zum Bundestagsabgeordneten auch gar kein Problem war, denn seine monatliche Diät bemaß sich damals auf 6.878 Euro brutto.
Die Menschen, mit denen Spahn überhaupt sprach, bemerkten sehr schnell seine Ambitionen auf eine Raketenkarriere, was er offen mit der Einsicht „bekannt werden, nicht unbedingt beliebt“ verband, wobei er sich auf Konrad Adenauer berief. Da ist es nur konsequent, sich stets für jenen Bereich zu interessieren, der das Potenzial für die größten Aufstiegschancen hat. Das komplexe Thema Gesundheit scheuen viele Politiker, aber Spahn weiß sehr wohl, wie wichtig allen Menschen ihre Gesundheit ist.
So nimmt es nicht wunder, dass Spahn bald Obmann der Unionsfraktion im Gesundheitsausschuss wurde. 2005 startete die erste Große Koalition unter Führung von Angela Merkel. Spahn gestaltete damals die Gesundheitsreform mit. Gemeinsam mit einem befreundeten Lobbyisten und seinem Bürochef gründete er die Agentur Politas, die unter anderem Kunden aus dem Pharmabereich berät. Gute Kontakte in den Bundestag sind ein leuchtendes Aushängeschild der Agentur.
Doch das Firmenkonstrukt war offenbar nicht diskret genug, denn nach ein paar Jahren flog es auf. Zu diesem Zeitpunkt hat Spahn seine Anteile natürlich schon längst verkauft, so jedenfalls wird zumindest argumentiert.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Die Rente ins Visier nehmen lohnt sich
Selbstverständlich lässt sich mit dem Thema private Altersvorsorge Geld verdienen, viel sogar, wenn man die Rentenerhöhung (2008) als „Wahlgeschenk“ plakativ ablehnt. Dies hatte zunächst einen „Aufstand der Alten“ in seiner westfälischen Heimat zur Folge. Komisch, aber Mitte 2009 wird Spahn in einen Aufsichtsrat berufen.
Es ist zufälligerweise jener der Signal Iduna Pensionskasse. Den lukrativen Posten legt er aber schon 2010 selbst nieder, weil er nun zum gesundheitspolitischen Sprecher der Union aufgestiegen ist. Da machen sich mögliche Interessenkonflikte gar nicht gut.
Back to the roots
Mit seinen zehn Jahren Erfahrung im Stadtrat von Ahaus im Verein mit seinem wachsenden bundesweiten Bekanntheitsgrad zog er im Jahre 2009 in den Münsterländer Kreistag ein und unterstützte seinen guten alten Freund aus der Jungen Union Kai Zwicker darin, Landrat zu werden.
Im selben Jahr wurden beide im Kreis Borken in den Verwaltungsrat der Sparkasse Westmünsterland berufen. Dass Sitze in den Aufsichtsgremien von Sparkassen an Kommunalpolitiker vergeben werden, ist ja auch schon lange völlig normal in Deutschland. So kann eine Hand einfacher die andere waschen. Dass solche Posten bei wenig Arbeit gut dotiert sind, tut ja der Sache keinen Abbruch.
Die Jahresabschlüsse der Sparkasse weisen in der Zeit von 2011 bis 2015 für Spahn jedenfalls 10.000 Euro brutto pro Jahr aus. Gewiss ist dies nicht weiter nennenswert bei jemandem, der im Bundestag in jedem dieser Jahre ungefähr 100.000 Euro Diäten erhält.
Daher ist es doch nur gut, dass sich neben dem Posten im Verwaltungsrat noch weitere Nebenverdienste für Spahn auftun.
Im Jahr 2012 tritt jene Bank, bei der Spahn den Kredit für die Eigentumswohnung zu laufen hat, einen Teil ihrer Forderung zufällig an die Sparkasse Westmünsterland ab. Und vier Jahre später übernimmt diese noch einen weiteren beachtlichen Teil dieses Kredits.
Mit Ausdauer und seinem Durchsetzungsvermögen hat sich Spahn 2013 in einer Kampfabstimmung gegen Hermann Gröhe für das CDU-Präsidium qualifiziert. Die Partei hat seinen Einflussreichtum inzwischen verstanden. Kein Geringerer als der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble band Spahn in die Regierung ein. Spahn wurde Parlamentarischer Staatssekretär im Finanzressort.
Er nutzte diesen Job im Ministerium, der von anderen eher als Karriere-Sackgasse belächelt wird, um sich das komplexe Gebiet der Finanztechnologie zu erschließen. Es war die Zeit, als er auf eine „pfiffige Idee“ stieß, in die er bald investieren sollte. Die Rede ist von der „Pareton GmbH“, von der er nun 1,25 Prozent besaß. Produziert wird von dem Start-up Unternehmen Steuer-Software.
Warum denn nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Für sein engagiertes Investment bekam Spahn sogar noch 3.000 Euro staatliche Zuschüsse aus Fördermitteln des Wirtschaftsministeriums. Am Ende nervte ihn die öffentliche Meinung darüber so sehr, dass er den Zuschuss zurückzahlte und jener Firma den Rücken kehrte.
Reich durch boomende Immobilien
2015 kaufte Spahn eine Wohnung in Berlin-Schöneberg und vermietete sie an Christian Lindner (FDP). Zwei Jahre danach kaufte er eine noch teurere Wohnung ganz in der Nähe. In diesem Kontext ist noch ein Zitat aus dem Jahr 2018 von Spahn recht interessant: „Niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe“. Aber er setzte gleich noch einen drauf: „Hartz IV bedeutet nicht Armut“. Denn dies sei die Antwort einer Solidargemeinschaft auf die Armut. So hat eben jeder das, was er braucht.
Zwar sind Spahns Parteifreunde nicht immer amüsiert über seine Sprüche, aber für Schlagzeilen sind diese ja dann doch gut, und was in aller Munde bekannt macht, bringt bekanntlich weiter. Dumm nur, dass es gerade solche Worte waren, die nun eine große Neugier hinsichtlich Spahns Einkünfte geweckt haben.
Dabei kam so ganz nebenbei heraus, dass er eine der Eigentumswohnungen von jenem Pharmamanager gekauft hat, der die Geschäftsführung für die Gematik GmbH übernommen hat, maßgeblich lanciert aus dem Gesundheitsministerium, wobei in diesem Zuge das Gehalt für diesen Posten sprunghaft angestiegen ist.
Schonungslose Berichterstattung ist nicht jedermanns Sache
Gegen all die Offenlegungen seine Berliner Immobilien betreffend sollten seine Anwälte im Verein mit den Amtsrichtern Unterlassungserklärungen erzwingen, eine Rechnung, die am Ende aber nicht so ganz aufging.
Fairerweise sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass weder Jens Spahn noch andere Personen in seinem unmittelbaren Umfeld in irgendeiner Weise ein strafrechtlich relevantes Verhalten an den Tag gelegt haben. Sowohl die angesprochenen Kreditvergaben als auch Spahns Unternehmensbeteiligungen waren und sind rechtlich nicht zu beanstanden.
Dennoch wirkt Jens Spahn aktuell etwas angezählt, denn neben einem nicht zu übersehenden Missmanagement bei der Pandemie haben inzwischen viele seiner Parteimitglieder verstanden, dass Jens Spahn offenbar mehr Freude am Geldscheffeln als an seiner politischen Karriere hat.
Kleiner Tipp für Jens Spahn
Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Ohren nahe am Volke. Nicht zuletzt deshalb rät er allen Abgeordneten, dass sie sich prinzipiell zwischen der Wirtschaft und der Politik entscheiden sollten, Konto oder Blaulicht, wie er es nennt. Auf Dauer kann nur eines davon gut gehen. Im Übrigen kann man ja nicht sagen, dass Politiker am Hungertuch nagen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an: